Lena Christ: Erinnerungen einer Überflüssigen
Besprechung
Ein frühes Zeugnis autofiktionalen Schreibens
Lena Christs Roman würde man heute wohl als Autofiktion bezeichnen, schildert die 1881 in Glonn geborene uneheliche Tochter einer Köchin doch darin ihr Leben bis zum Jahr 1909, in dem sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann trennt und aus wirtschaftlicher Not ihre sechs Kinder in ein Heim geben muss.
Die Ich-Erzählerin verbringt die ersten Lebensjahre bei ihren Großeltern und erfährt vor allem von ihrem Großvater Liebe und Zuwendung. Nach seinem Tod wird sie allerdings von ihrer hartherzigen und skrupellosen Mutter nach München geholt und als Dienstmagd und Kellnerin in der gepachteten Gastwirtschaft brutal ausgebeutet. Häufig wird die Ich-Erzählerin von der Mutter bei der geringsten Nachlässigkeit unflätig beschimpft und unbarmherzig misshandelt. Die Halbwüchsige versucht mehrmals, diesem erniedrigenden und unerträglichen Leben zu entfliehen, wird von der Mutter aber immer wieder zurückgeholt, die ihr jedes Mal verspricht, sich zu bessern. Eine gewisse Zeit lang wird Lena danach tatsächlich freundlicher behandelt, aber die Rückfälle der Mutter in ihre Gewaltorgien lassen nicht zu, dass Lena dauerhaft zur Ruhe kommt und glücklich wird. Schließlich tritt Lena sogar in ein Kloster ein und versucht, Nonne zu werden. Aber auch dieses Leben sagt der lebhaften und ursprünglich fröhlichen und neugierigen jungen Frau nicht zu und sie kehrt doch wieder in die Gaststätte der Mutter zurück. Für kurze Zeit fühlt sich Lena nicht als Überflüssige, als es ihr endlich gelingt, dem Machtbereich der Mutter zu entkommen und in einem Lokal Arbeit als Kellnerin zu finden. Dort wird sie endlich gelobt für ihren Fleiß, fühlt sich gebraucht und anerkannt. Außerdem verdient sie endlich Geld, denn ihre Freundlichkeit wird von den Gästen mit großzügigen Trinkgeldern belohnt. Ein weiteres Mal lässt sie sich von der Mutter überreden, zu ihr zurückzukehren und für sie zu arbeiten. Zunächst läuft es besser, Lena wird auch bezahlt, aber bald ist alles wieder beim Alten. Der letzte Fluchtversuch in ein anderes Leben gelingt zwar, Lena wirft sich recht überstürzt in die Ehe mit einem Buchhalter, dessen Eltern jedoch wenig begeistert davon sind, dass er eine uneheliche Tochter aus einem Wirtshaus heiratet. Aber diese Ehe führt für Lena erst recht in die Katastrophe. Benno Hasler entpuppt sich als fauler, brutaler Mann, der Lenas Ersparnisse und sein Erbe im Wirtshaus und beim Kartenspielen verprasst und schließlich auch seine Arbeitsstelle verliert. Lena hat inzwischen sechs Kinder geboren und da Benno sich nicht mehr um sie kümmert, landet sie auf der Straße. Weder ihre Mutter noch ihre Schwiegereltern helfen ihr.
Didaktische Hinweise
Lena Christ beschreibt die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Zeit um 1900 ungeschönt und zeichnet ihre Figuren mit all ihren negativen und abstoßenden Seiten. Dabei entsteht das Bild einer mitleidlosen und reaktionären Gesellschaft, die jede Abweichung gnadenlos bestraft. Die zunächst unbedarfte und freundliche Lena kann sich aus den Grenzen, die ihr aufgrund ihrer Herkunft als uneheliches Kind einer Dienstmagd gesetzt sind, letztlich nicht befreien. Zwar gelingt es der Autorin selbst, zumindest eine Weile mit ihren Büchern Erfolg zu haben, aber erneut gerät sie in die Abhängigkeit von einem Mann, und als der wirtschaftliche Erfolg wieder ausbleibt und sie womöglich aufgrund eines Betrugsdelikts ins Gefängnis muss, begeht sie im Jahr 1920 Selbstmord.
Mehrmals in den hundert Jahren nach ihrem Tod wurde die Autorin wiederentdeckt, zuletzt im Jahr 2012, als in der Monacensia in München eine große Ausstellung zu ihrem Werk und ihrem Leben eröffnet wurde. Die damalige Kuratorin Gunna Wendt hat eine ausführliche Biographie zu Lena Christ geschrieben. Auch Asta Scheibs Werk über die Autorin kann begleitend im Unterricht verwendet werden. Allerdings gibt es zurzeit leider weder Materialien noch eine für den Unterricht aufbereitete Ausgabe ihrer Werke. Das ist sehr bedauerlich, denn zeitlich ließe sich Lena Christs Werk durchaus als Literatur um 1900 in der Oberstufe einsetzen; darüber hinaus wäre ein W-Seminar über die Autorin eine gewinnbringende Sache, denn auch ihre anderen Werke wie „Die Rumpelhanni“, „Madam Bäuerin“ oder „Mathias Bichler“ handeln von Themen, die Jugendliche interessieren könnten: gesellschaftliche Ausgrenzung, erfolgreicher oder erfolgloser sozialer Aufstieg, das Leben unterprivilegierter Frauen um 1900. Da die Dialoge im bairischen Dialekt wiedergegeben werden, lässt sich auch das Thema „Dialekt“ mit Lena Christs „Erinnerungen einer Überflüssigen“ abdecken.
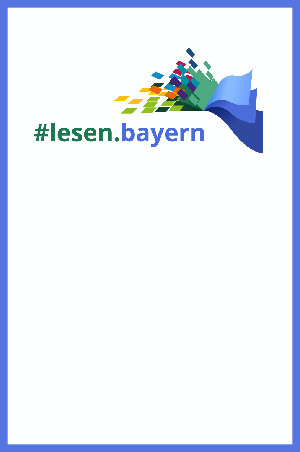
Gattung
- Sachbücher
Sachbuchkategorie
- Biografien, Autobiografien, Porträts
Eignung
themenspezifisch geeignetAltersempfehlung
Jgst. 12 bis 13Fächer
- Deutsch
FÜZ
- Soziales Lernen
- Sprachliche Bildung
- Werteerziehung
Erscheinungsjahr
2019ISBN
9783849669447Umfang
160 SeitenMedien
- Buch


